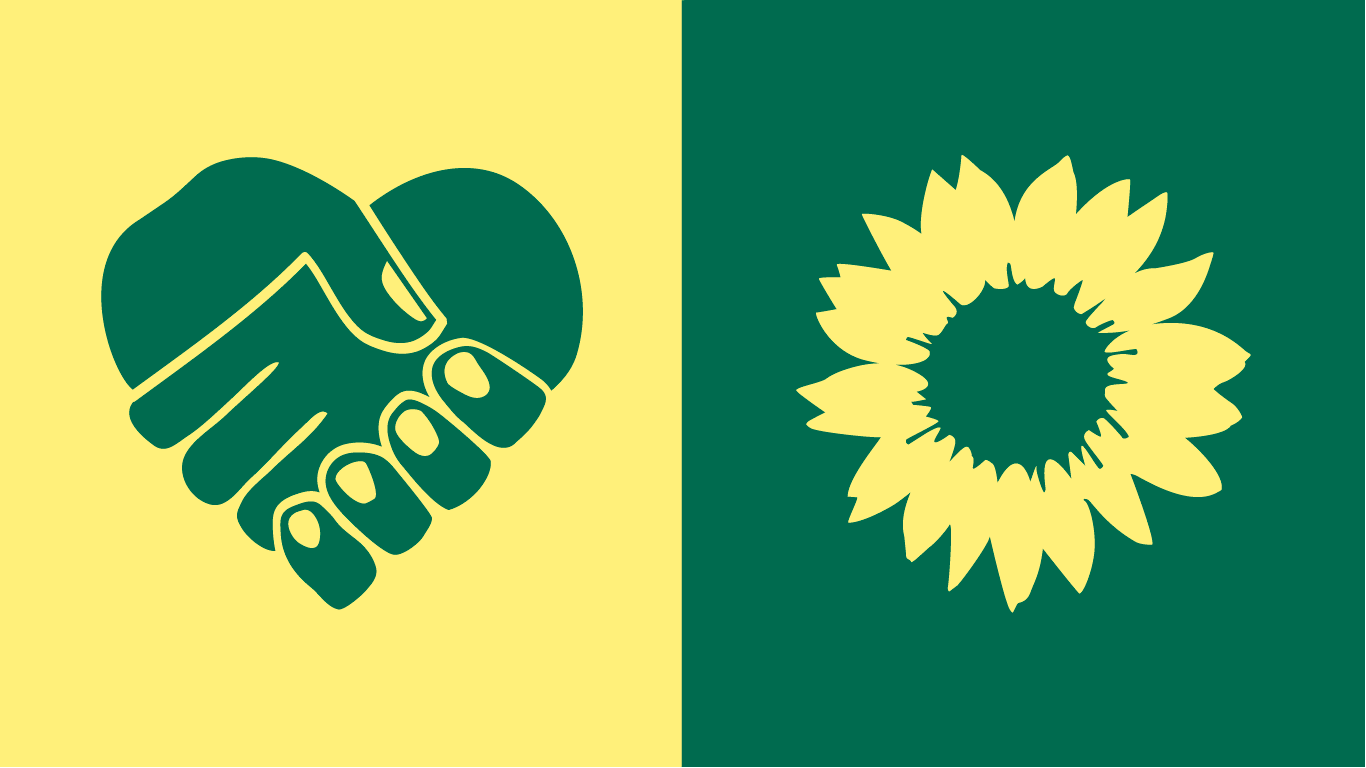Seltsames Engagement eines Stadtverordneten für einen neuen riesigen Solarpark im Ortsteil Müncheberg
Unter der Sitzungsvorlage 0580/24 stand der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan zum Solarpark „Augustenaue“ auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses der Stadtverordnetenversammlung Müncheberg, die am 25.09. stattfand.
Das Vorhaben der GGE Enviria Solar GmbH & Co. KG mit einer geplanten Leistung von bis zu 60 MWp hatte bereits zuvor für erhebliche Unruhe unter den Anwohner*innen gesorgt. Der Vorhabenträger hatte diese schriftlich kontaktiert und um Zustimmung zur Abweichung vom festgelegten Kriterienkatalog der Stadt Müncheberg gebeten – insbesondere hinsichtlich des vorgeschriebenen Mindestabstands von 500 Metern zur Wohnbebauung.
Zweifelhaftes Vorgehen des Vorhabenträgers
Am 24.05. fand eine von Enviria organisierte Anwohnerversammlung in der Kirche statt. Teilnehmende berichteten im Nachgang, dass Enviria in dieser Veranstaltung die rechtliche Verbindlichkeit der von der Stadt beschlossenen Kriterien in Zweifel zog – und indirekt damit drohte, das Vorhaben ggf. gerichtlich durchzusetzen, sollte auf deren Einhaltung bestanden werden.
Inzwischen hatte Enviria einen formellen Antrag auf Einleitung eines Bauleitplanverfahrens gestellt. Die Verwaltung prüfte diesen sorgfältig und kam zu dem Ergebnis, dass zwei zentrale Kriterien nicht erfüllt wurden:
- Der Mindestabstand von 500 m zur Wohnbebauung wird nicht eingehalten, und die Zustimmung der Mehrheit der betroffenen Anwohner*innen konnte nicht nachgewiesen werden.
- Ein Flurstück im Eigentum der Stadt Müncheberg wurde ohne vorherige Klärung mit der Stadt in die Planung einbezogen. Laut Enviria sei das Flurstück „…aus Versehen im Antrag gelandet“.
Die Verwaltung empfahl daher den Stadtverordneten, der Einleitung des Bauleitplanverfahrens nicht zuzustimmen.
Kritik, Vertagungsforderung und Ablehnung im Ausschuss
Im Bauausschuss erschienen daraufhin zwei Vertreter*innen der Firma Enviria. Stadtverordneter Herr Hoedtbeantragte Rederecht für sie. In ihren Beiträgen übten sie Kritik an der Verwaltung – insbesondere wegen angeblich mangelhafter Kommunikation und der Zweckmäßigkeit des Kriterienkatalogs. Die meisten Ausschussmitglieder zeigten sich von diesen Ausführungen nicht überzeugt.
Herr Hoedt warf der Verwaltung vor, bei Windkraftprojekten großzügiger mit den Kriterien umzugehen, während man sich hier zu wenig kooperativ zeige. Er forderte zudem eine Vertagung der Entscheidung und eine erneute Behandlung im Ortsbeirat Müncheberg. Die anwesende Vorsitzende des Ortsbeirats, Frau Roth, wies dies jedoch zurück – der Beirat habe sich bereits mit dem Thema befasst und die Vorlage abgelehnt.
Am Ende wurde die Vorlage im Bauausschuss mehrheitlich abgelehnt.
Fragen zum Engagement von Herrn Hoedt
Angesichts des ungewöhnlich starken Einsatzes von Herrn Hoedt für dieses Projekt stellen sich berechtigte Fragen – die letztlich nur er selbst beantworten kann. Gerade weil es rund um Müncheberg eine Vielzahl von beantragten Solarparks gibt, wirkt das Eintreten für ein Vorhaben, das in mehrfacher Hinsicht gegen städtische Vorgaben verstößt, umso fragwürdiger. Hier drängt sich der Eindruck auf, dass ein Projekt möglicherweise im Interesse von Grundstückseigentümern und Investoren durchgewunken werden sollte – trotz berechtigter Bedenken.
Unterschiede zwischen Windkraft- und Solaranlagen
Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass sich die Genehmigungsverfahren für Windkraft- und Solaranlagenrechtlich deutlich unterscheiden:
- Windkraftanlagen gelten nach dem Baugesetzbuch als privilegierte Vorhaben im Außenbereich. Die Kommune hat hier nur sehr begrenzte Einflussmöglichkeiten.
- Photovoltaik-Freiflächenanlagen hingegen erfordern in den meisten Fällen die Aufstellung eines Bebauungsplans durch die Kommune. Diese hat hier eine weitreichende Gestaltungshoheit und kann über einen Kriterienkatalog festlegen, wo und unter welchen Bedingungen solche Anlagen zulässig sind.
Deshalb ist es irreführend, bei Windkraftanlagen von einem „Aufweichen“ der Grenzen zu sprechen, wenn der gesetzlich vorgegebene Mindestabstand zu Wohnbebauung innerhalb von Ortschaften eingehalten wird, auch wenn der Abstand zu einzelnen Häusern außerhalb der Ortschaft geringer ausfällt – dies ist baurechtlich zulässig.
Bei PV-Freiflächenanlagen sieht das anders aus: Wird hier der selbst festgelegte Mindestabstand von 500 m zur Wohnbebauung unterschritten, kann man sehr wohl von einem Aufweichen der kommunalen Kriterien sprechen – und das ist in diesem Fall geschehen.
Lust auf Kontakt?!
Email: info@zukunft-muencheberg.de